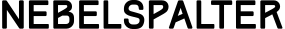Das ist passiert: Die stellvertretende Direktorin des Bundesamtes für Justiz hat ein Gutachten verfasst, das zum Schluss kommt, dass die Rahmenverträge mit der EU nur dem fakultativen Referendum unterstellt werden sollten, also nur dem Volk und nicht den Ständen.
Der Löli Faktor: Kuster begründet diese Aussage ausschliesslich mit der aktuellen Bundesverfassung und dass es bisher nicht oft vorgekommen sei («Verfassungsgewohnheitsrecht»). Dies, obwohl das sogenannte obligatorische Staatsrechtsreferendum sui generis bereits mehrmals zur Anwendung kam (EWR 1992, Freihandelsabkommen mit EWG 1972, Völkerbund 1920).
- Dass das obligatorische Staatsrechtsreferendum sui generis nicht in der Verfassung beschrieben ist, war bewusst so entscheiden worden. Dies sieht Frau Kuster als Indiz, dass es eben heute nicht mehr gelten soll:
«Dass die fragliche Praxis zum Staatsvertragsreferendum sui generis ergangen ist, als noch die Bundesverfassung von 1874 galt, spricht daher ebenfalls dagegen, dass es im heute massgebenden Referenzrahmen der geltenden Bundesverfassung ein verfassungsgewohnheitsrechtliches Staatsvertragsreferendum sui generis gibt.»
Susanne Kuster
-
Bloss: Ein Blick in die Ratsdebatte zur Verfassungsrevision 1999 bestätigt: Vorgesehen ist es nach wie vor:
«Wir haben darauf verzichtet, eine solche Bestimmung aufzunehmen, weil ein solcher absoluter Ausnahmefall in der Verfassung wohl kaum befriedigend geregelt werden kann.»
Bruno Frick, CVP-Ständerat
aus: Debatte zur Verfassungsrevision, 9. März 1998
- Die Verfassungskommission des Ständerats war aber klar der Ansicht, dass «in ausserordentlichen Fällen – diese sind aber sehr selten – die Bundesversammlung weiterhin das Recht haben soll, neben der geschriebenen Verfassung als ausserordentliche Massnahme, gleichsam als ‹Ventil›, besonders wichtige Staatsverträge Volk und Ständen zur Abstimmung zu unterbreiten.» Kuster lässt diese Information in ihrem Gutachten einfach weg.
- Ähnliches gilt für die Debatte im Nationalrat und späteren Versuchen, die Möglichkeit des obligatorischen Referendums mit Ständemehr festzuschreiben: Darauf wurde jeweils verzichtet – aber stets mit dem Hinweis, es gäbe diese Möglichkeit auch als ungeschriebenes Recht.
-
Insgesamt gab es nur drei Mal ein solches obligatorisches Referendum, das vom Parlament beschlossen wurde: beim Beitritt zum Völkerbund, der Abstimmung über das Freihandelsabkommen und beim EWR-Vertrag. Die Seltenheit solcher Abstimmungen ist für Kuster ein Argument, dass ein Verfassungsgewohnheitsrecht zu dieser Bestimmung nicht existiere:
«Das gilt umso mehr, als sich zwei der drei Anwendungsfälle des Staatsvertragsreferendums sui generis ereignet hatten, bevor das obligatorische Staatsvertragsreferendum überhaupt eingeführt wurde.»
Susanne Kuster
- Auch der Bundesrat äusserte sich erst kürzlich zur Frage des obligatorischen Staatsrechtsreferendums sui generis:
«Völkerrechtliche Verträge unterstehen zunächst dann dem obligatorischen Staatsvertragsreferendum, wenn sie ‹Bestimmungen von Verfassungsrang› enthalten.»
Bundesrat
Botschaft zum obligatorischen Referendum für völkerrechtliche Verträge mit Verfassungscharakter, 15. Januar 2020
- Damit meinte er namentlich «Bestimmungen, welche in den Bestand der Grundrechte eingreifen, zu einer Verschiebung von Bundes- und Kantonskompetenzen führen oder die Grundzüge der Organisation oder des Verfahrens der Bundesbehörden verändern.» Auch in diesem Zusammenhang winkt Frau Kuster ab:
«Insbesondere das Nichteintreten der Bundesversammlung auf die Vorlage des Bundesrats vom 15. Januar 2020 ist ein Indiz dafür, dass die geteilte Rechtsüberzeugung fehlt, die notwendig wäre, damit Gewohnheitsrecht entstehen könnte (opinio juris).»
Susanne Kuster
- Die zuständige Vertreterin der Kommission, die Tessiner Nationalrätin Greta Gysin, erklärte auch hier ausdrücklich, dass man auf den Vorschlag nicht eingetreten ist, eben weil es bereits möglich sei:
«Die Möglichkeit, dass die Bundesversammlung den Vertrag dem Referendum sui generis unterstellt, bleibt ebenso bestehen wie die Möglichkeit, das fakultative Referendum zu ergreifen.»
Greta Gysin
Grüne Nationalrätin aus dem Tessin und Sprecherin für die Kommission (2020)
- Diese Überlegungen sollten laut Gysin die Gemüter beruhigen und die Bedenken der Befürworter einer Verankerung des obligatorischen Staatsvertragsreferendums sui generis in der Verfassung zerstreuen. Auch dies verschweigt Kuster gekonnt.
- Es kämen laut Kuster ohnehin nur «Staatsverträge in Betracht, die selbst bestimmte Grundelemente der Bundesverfassung offenkundig aushebelten.» Da dies nicht zu erwarten sei, würde das obligatorische Staatsvertragsreferendum sui generis «aller Voraussicht nach ausser Betracht bleiben».
Was Kuster auch nicht erwähnt: Das Standardwerk zum Verfassungsrecht, der Kommentar zur Bundesverfassung von Giovanni Biaggini, findet in Kusters Gutachten keine Erwähnung. Denn auch dieser spricht eine klare Sprache: Die Bundesversammlung kann wichtige völkerrechtliche Verträge dem obligatorischen Referendum unterstellen, was die Notwendigkeit des Ständemehrs mit sich ziehen würde:
«Unter diesen Umständen ist wohl davon auszugehen, dass es auch weiterhin zulässig ist, im Einzelfall weitere Verträge (ausnahmsweise) dem obligatorischen Referendum zu unterstellen.»
Giovanni Biaggini
Kommentar zur Bundesverfassung, 2. Auflage, 15. Dezember 2017
Rechtsdogmatisch sei das gewillkürte obligatorische Referendum gemäss Biaggini als ein Fall ungeschriebenen Verfassungsrechts einzustufen.
Aufgefallen: Noch vor wenigen Jahren äusserte sich Kuster ganz anders zu dieser Frage. Gegenüber der «NZZ» sagte sie, das Bundesamt für Justiz wolle mit einer juristischen Beurteilung zuwarten, bis die endgültige Vorlage über das Rahmenabkommen bekannt sei:
- «Der Bundesrat und später das Parlament werden das zur gegebenen Zeit entscheiden», sagte Susanne Kuster im Januar 2020.
- Wenn ein definitiver Abkommenstext vorliege, müsse man diesen systematisch analysieren und prüfen, ob er ähnlich bedeutende Bestimmungen enthalte wie die Verfassung.
Nun sollte sie dem Entscheid des Bundesrats vorgreifen. Auch wenn der Auftrag dazu vom Bundesrat und vor allem ihrem Chef Beat Jans stammen dürfte: So nicht, Frau Kuster.