News zum Nebelspalter
Mitteilungen in eigener Sache.
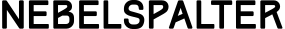

Freie Gedanken, freie Märkte, freie Menschen.
Der Nebelspalter will den Nebel spalten, in den uns Politiker, Beamten, Pressesprecher, Manager und leider auch manche Journalisten und Wissenschaftler hüllen. Wir suchen nach der Wahrheit. Wir hassen den Nebel und das Nebulöse.
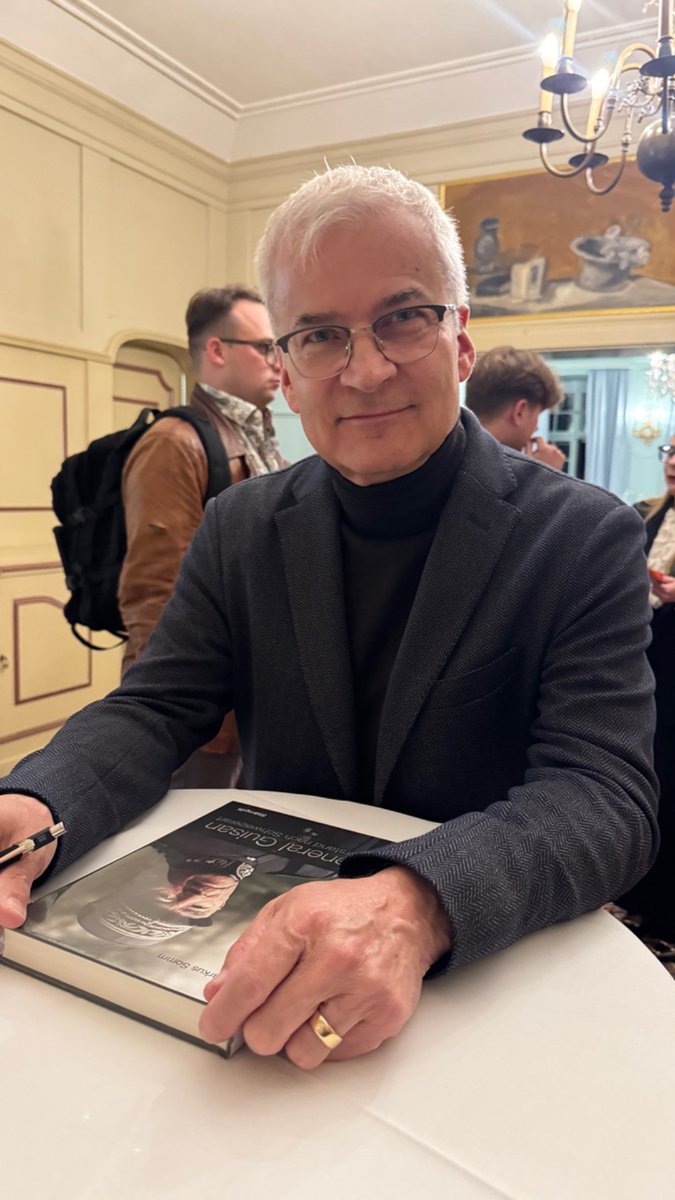
Verleger und Chefredaktor
E-Mail
Mehr zu Markus Somm

Stv. Chefredaktor und Leiter Bundeshausredaktion
E-Mail
Mehr zu Dominik Feusi

Redaktorin
Moderatorin «Nebelspalterinnen»
E-Mail
Mehr über Camille Lothe

Bundeshausredaktor
E-Mail
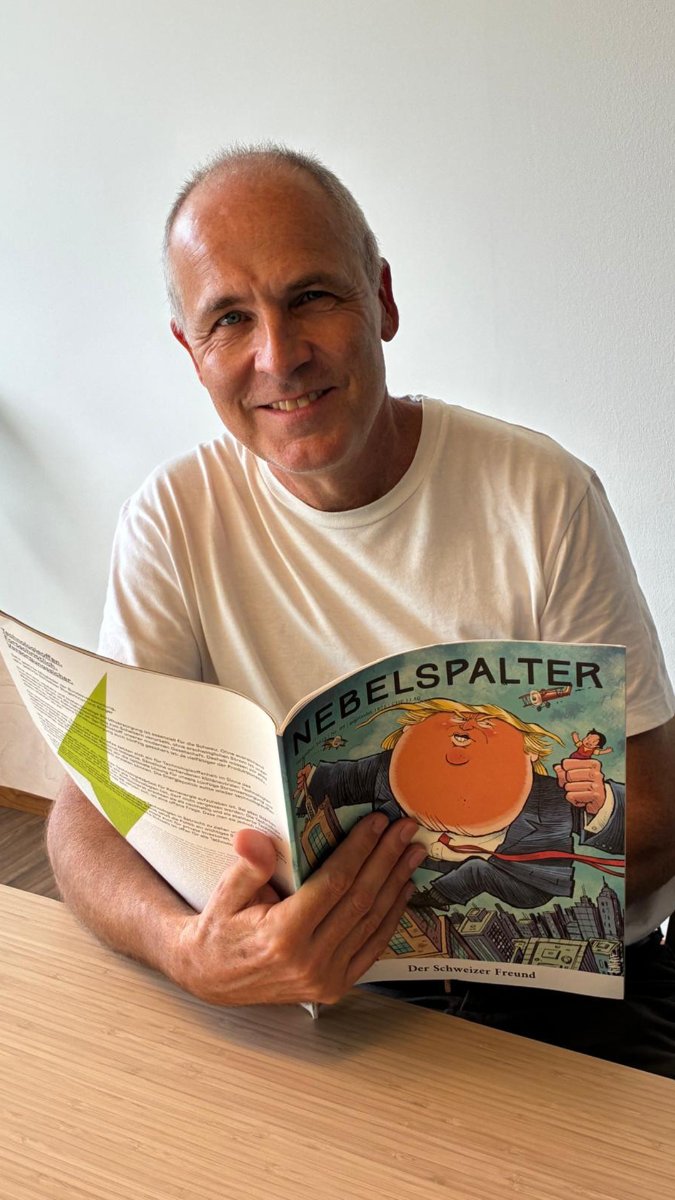
Redaktor
E-Mail
Mehr zu Alex Reichmuth
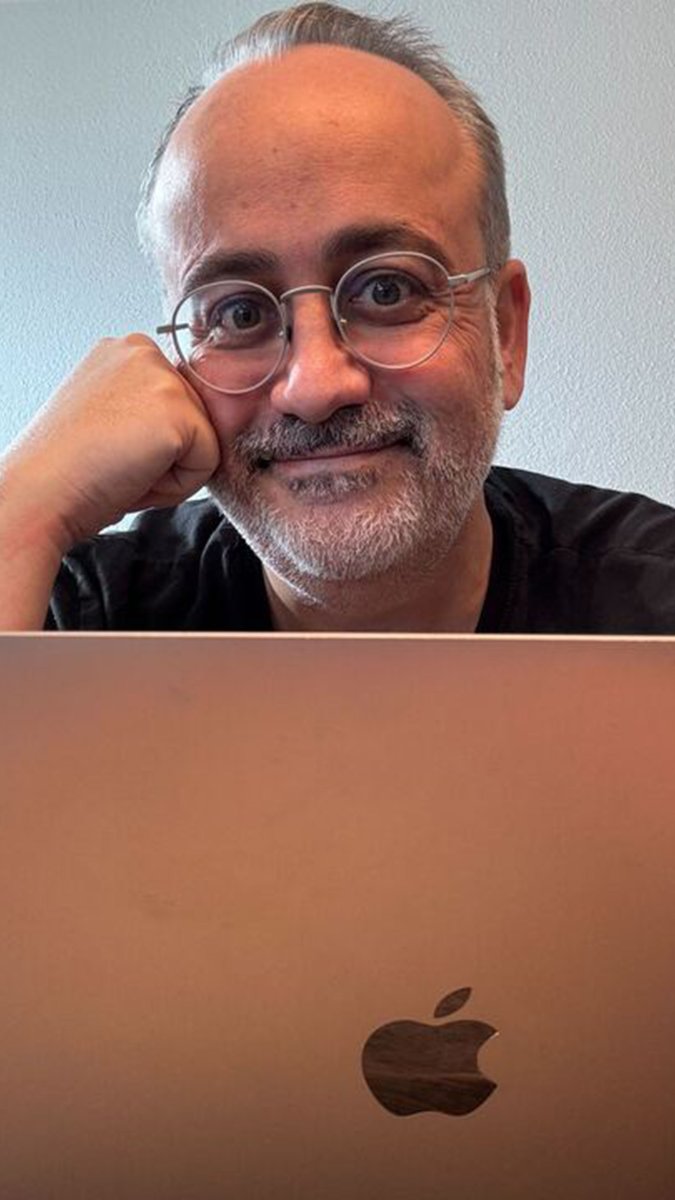
Journalist & Autor
E-Mail

Leitung Marketing|
Events|Customer Relations
E-Mail

Leitung Administration
Direktionsassistentin
E-Mail

Buchhaltung
E-Mail