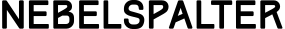Was sind die politischen Auswirkungen der Verträge?
Die Schweiz verpflichtet sich mit den Rahmenverträgen zur Übernahme von heutigen und künftigem EU-Recht in den von den Verträgen betroffenen Bereichen. Genau und abschliessend definiert sind diese Bereiche nicht. Ausgenommen davon sind zum Beispiel Verschlechterungen des Lohnschutzes, die Ausschaffung von EU-Bürgern und die Landwirtschaft.
Die EU verspricht jedoch, dass Schweizer Unternehmen «denselben Regeln und Verpflichtungen unterliegen wie die Unternehmen aus der EU». Das würde die Übernahme des gesamten Binnenmarktrechtes bedeuten.
Überwacht wird dies faktisch durch die EU-Kommission, weil sie das Streitbeilegungsverfahren in Gang setzen kann, wenn sie mit der Umsetzung durch die Schweiz nicht zufrieden ist. Bei der Streitbeilegung wendet ein Schiedsgericht die EU-Regeln und die Auslegung dieser Regeln durch den Gerichtshof der EU seit 1999 an und ist an dessen Entscheide gebunden.
«Für mich ist der politische Preis zu hoch. Die Verträge tangieren die direkte Demokratie der Schweiz.»
Ernst Baltensperger, emeritierter Wirtschaftprofessor und «Doyen der Schweizer Geldpolitik»
Kommt das Schiedsgericht so zum Schluss, dass die Schweiz gegen ihre Verpflichtungen verstösst, kann die EU die Schweiz mit «Ausgleichsmassnahmen» bestrafen. Diese Sanktionen müssen verhältnismässig sein. Die Strafaktionen der Vergangenheit hätten in Zukunft eine rechtliche Grundlage.
Damit greifen die Verträge tief in die demokratischen Institutionen und den politischen Prozess der Schweiz ein. Parlament oder Volk können zwar noch entscheiden, aber diese Entscheide dürfen dem EU-Recht nicht zuwider laufen, sonst wird die Schweiz mit Sanktionen belegt. Die demokratische Teilhabe ist nur solange frei, wie der Entscheid EU-Recht entspricht.
Das gibt selbst Bundesrat Ignazio Cassis zu: Er will in Zukunft die EU vor Abstimmung anfragen, was denn die Ausgleichsmassnahmen wären.
Die Verträge greifen deshalb nach Ansicht von zahlreichen Staatsrechtlern tief in das institutionelle Gefüge und die Demokratie ein. Weil sich die Schweiz auch zur Übernahme vom künftigen EU-Recht verpflichtet, könnten die politischen Konsequenzen der Rahmenverträge viel weiter gehen als jetzt bekannt.
Denn das, was jetzt unbekannt ist, wird in Zukunft von der EU und nicht von der Schweiz gefüllt: durch ihr Recht und die Rechtssprechung ihres Gerichtshofes.
«Bei diesen Abkommen geht es um die Säulen unseres Staates: die demokratische Teilhabe und das Vertrauen in das Parlament. Ohne dieses Vertrauen, das die Schweiz bisher ausgezeichnet hat, ist auch der Wohlstand gefährdet.»
Oliver Zimmer, Historiker und Ex-Oxford-Professor
Bei fünf Verträgen gilt zudem das Integrationsverfahren: EU-Recht gilt direkt in der Schweiz. Der Bundesrat gibt dies in seinen Erläuterungen (S. 75, PDF) unumwunden zu und schreibt: «Diese Rechtsakte werden von der Schweiz grundsätzlich direkt angewendet, ohne dass sie in das Landesrecht überführt werden müssen».
Das bedeutet, dass der demokratische Prozess vollständig ausgeschaltet wird. Das ist faktisch eine automatische Rechtsübernahme.
Fazit: Der politische Preis der Rahmenverträge ist gross und wird in Zukunft noch grösser werden.