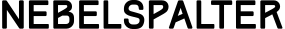Was ist das Streitbeilegungsverfahren?
Der Kern der institutionellen Vereinbarungen bildet ein Verfahren, wie die EU und die Schweiz unterschiedliche Ansichten klären. Heute geschieht das im gemischten Ausschuss – und wenn die beiden Seiten sich nicht einig werden, dann passiert nichts. Genau das ist der EU seit Jahren ein Dorn im Auge.
Neu kann jede Seite ein Verfahren in Gang setzen. Das führt dazu, dass die EU-Kommission faktisch die Schweiz überwacht. Dazu wird ein Schiedsgericht gebildet aus je einem Vertreter der EU und der Schweiz. Diese beiden wählen dann einen dritten Richter.
«Oft wird das Schiedsgericht den Europäischen Gerichtshof nicht einmal beiziehen müssen, weil seine Position aus seinen Urteilen bereits klar ist.»
Andreas Glaser, Professor für Staatsrecht
Entscheidend ist: Das Schiedsgericht wendet bei seiner Arbeit die Urteile des Gerichtshofes der EU (EuGH) an, denn es ist der EuGH, der EU-Recht und EU-Rechtsbegriffe auslegt.
Wenn der Fall mit den bestehenden Urteilen nicht zu lösen ist, dann muss das Schiedsgericht den EuGH fragen. Dieser fällt eine «Entscheidung» und diese ist für das Schiedsgericht «bindend» (siehe zum Beispiel S. 13, Änderungsprotokoll zum MRA, PDF). Carl Baudenbacher, der frühere Präsident des EFTA-Gerichtshofes nennt das Gericht deshalb «Scheinschiedsgericht».
Unterliegt die Schweiz vor dem Schiedsgericht, so kann die EU sogenannte «Ausgleichsmassnahmen» ergreifen – in allen Verträgen ausser der Landwirtschaft. Sie kann die Schweiz also wie bisher bestrafen, neu jedoch nach einem Verfahren und mit einer rechtlichen Grundlage.
Fazit: Das Streitbeilegungsverfahren gibt der EU-Kommission die Möglichkeit, die Schweiz zu überwachen, und jederzeit ein Schiedsgericht einzuberufen, das auf der Basis der Rechtssprechung des EuGH beurteilt, was die Schweiz zu tun hat.