Unterstützen Sie den Nebelspalter
Mit einem Betrag nach eigenem Ermessen unterstützen Sie die Recherchen des Nebelspalters zum Rahmenabkommen.
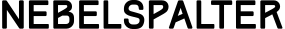
Bei den Rahmenverträgen geht es nicht um den Marktzugang. Dieser besteht wegen dem Freihandelsabkommen von 1972 und der Welthandelsorganisation WTO, die nicht Gegenstand der Rahmenverträge sind. Es geht einzig um die gegenseitige Anerkennung von Produktzulassungen von zwanzig Industriebranchen, von denen die meisten ihre Zulassung bereits in der EU machen lassen – weil sie dort billiger sind.
Auch das ist falsch, wie die vom Bundesrat in Auftrag gegebene Studie zeigt. Das hat damit zu tun, dass nur ein kleiner Teil der Wirtschaft von den Abkommen betroffen ist und deren Nutzen für diese Branchen gemäss den Befürwortern «0,5 bis 1 Prozent» beträgt (zur genauen Berechnung geht es hier).
Paul Richli, Jurist und ehem. Rektor der Uni Luzern
Angesichts von 1’700 Rechtsakten, welche die EU durchschnittlich jedes Jahr erlässt, ist dies ein schwaches Argument. Es ist zudem in den Verträgen nicht eindeutig geregelt, welche dieser Rechtsakte von der Schweiz übernommen werden müssen und welche nicht. Die Unsicherheit darüber ist vorprogrammiert.
Zudem plant der Bundesrat bereits jetzt Rechtsbrüche: Er will eine Schutzklausel ins schweizerische Gesetz schreiben, welche EU-Recht widerspricht und die Spesenregelung der EU will er gar nicht umsetzen. Wie die EU mit (schriftlichen) Zusicherungen umgeht, erlebt derzeit die Stahlindustrie.
Die Verrechtlichung von Politik und die Delegation von wichtigen Politikbereichen an Brüssel führt zudem dazu, dass die Politik weniger zu sagen hat. In den von den Verträgen betroffenen Bereichen macht in Zukunft Brüssel und der Gerichtshof der EU die Politik. Bundesrat Ignazio Cassis sagt, die EU sei «ein bisschen besser vorhersehbar als die neue US-Regierung».
Aber reicht das? Politik als technokratischer Akt mit wenig oder gar keiner Teilnahme von Parlament und Volk. Mit dem Legitimationsdefizit schwindet das Vertrauen in Politik und in die Regeln. Die Verrechtlichung der Demokratie geht auf Kosten derselben.
Mindestens beim Äquivalenzverfahren ist das so. Allerdings drohen dann Ausgleichsmassnahmen durch die EU. Bundesrat Ignazio Cassis sagte, man werde Brüssel fragen, was die Ausgleichsmassnahmen sein werden. Wie kann man dann behaupten, die Demokratie sei nicht betroffen?
Schon beim Integrationsverfahren können das nur die Diplomaten im gemischten Ausschuss. Die Rahmenverträge werden deshalb die Macht von den gewählten Institutionen auf die Verwaltung und die EU verschieben.
Führende Staatsrechtler wie Professor Andreas Glaser sehen die direkte Demokratie in Gefahr: «Der Bundesrat wird in den Abstimmungserläuterungen schreiben, dass die Stimmberechtigten zum neuen EU-Rechtsakt Ja sagen müssen, weil das völkerrechtlich so abgemacht ist. Andernfalls muss die Schweiz Ausgleichsmassnahmen gewärtigen. Für die Abstimmungsfreiheit ist das ein Problem.» Der Luzerner Professor Paul richli findet, die freie Meiungsäusserung der Stimmbürger sei beeinträchtigt.
Oliver Zimmer, Historiker und Ex-Oxford-Professor
Jede Alternative muss mit der EU ausgehandelt werden. Deshalb liegt die nicht vor. Bloss: Bundesrat Ignazio Cassis betont gerne: «Lieber kein Abkommen als ein schlechtes Abkommen.» Sagt die Schweiz nein zu den Rahmenverträgen, bleibt alles so, wie es ist. Vermutlich würde die EU ihre diskriminierenden Massnahmen weiterführen oder gar verstärken.
Dass die EU die Verträge kündigt, ist jedoch unwahrscheinlich. Die Befürworter gehen eher von einer Erosion aus, die jedoch wirtschaftlich gemäss Bundesrat nicht ins Gewicht fallen würde. Die Schweiz könnte der EU die Verbindung von Wohlstand mit Souveränität vorschlagen und mit ihr ein modernes Freihandelsabkommen aushandeln, das selbst der EU mehr Wohlstand bringt.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein Andocken an den EWR-Institionen (wie es die EU-Kommission 2013 gemäss BR Burkhalter erwartete). Noch besser wäre ein neuer Europäischer Wirtschaftsraum, bei dem sich jene Länder beteiligen können, die zwar Freihandel in Europa wollen, aber keinen politisch rechtlichen Überbau. Genau das wäre der Freihandel in Europa, der den Kontinent reich gemacht hat.