Unterstützen Sie den Nebelspalter
Mit einem Betrag nach eigenem Ermessen unterstützen Sie die Recherchen des Nebelspalters zum Rahmenabkommen.
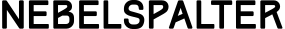
Die Schweiz verpflichtet sich, alles EU-Recht zu übernehmen, das in die Bereiche der Verträge fällt. Wo das genau aufhört, ist nicht abschliessend definiert. Bei der Übernahme gibt es zwei Vorgehensweisen:
Integrationsmethode: Das neue EU-Recht wird unmittelbar in der Schweiz wirksam. Es muss nicht durch das Parlament übernommen werden und kann deshalb auch nicht mit einem Referendum dem Volk vorgelegt werden. Die einzige Möglichkeit, dieses Recht nicht zu übernehmen, ist ein Nein im gemischten Ausschuss durch die Schweizer Diplomaten. Staatsrechtsprofessor Andreas Glaser sagt dazu: «Sollte ein Rechtsakt durchrutschen, ist es zu spät, dann gilt das EU-Recht mit allen Konsequenzen». Die Integrationsmethode gilt bei der Mehrheit der Verträge – und bei den politisch heiklen: Personenfreizügigkeit, Strom, Lebensmittel, Luftverkehr, Gesundheit
Äquivalenzmethode: Die neuen EU-Regeln gelten nicht automatisch in der Schweiz. Die Schweiz muss selbst dafür sorgen, dass ihre eigenen Gesetze oder Verordnungen den EU-Regeln entsprechen. Wie sie das genau macht, kann sie selbst entscheiden. Am Ende müssen die Schweizer Regeln zwar gleichwertig sein, aber nicht genau gleich wie die EU-Regeln. Diese sogenannte Äquivalenzmethode gibt der Schweiz also einen gewissen Spielraum. Sie gilt nur beim Abkommen über die technischen Handelshemmnisse und beim Landverkehr.
Gerhard Schwarz, Publizist und Ökonom
Hinzu kommt: Wenn die EU mit der Schweiz nicht einig wird, ob und wie sie EU-Recht übernimmt, kann die EU jederzeit das Streitbeilegungs-Verfahren in Gang setzen. So kann sie die Schweiz unter Druck setzen, EU-Recht zu übernehmen oder genau so zu übernehmen, wie es die EU will.
Fazit: Mit der «dynamischen Rechtsübernahme» gibt die Schweiz in den von den Verträgen betroffenen Bereichen die Politik an die EU ab. Sie kann EU-Recht nur noch ablehnen, wenn sie bereit ist, Ausgleichsmassnahmen zu leisten.