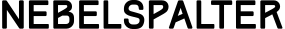Grosses Interview zum Fachkräftemangel
Professor Eichenberger: «Unser Steuersystem bestraft zusätzliche Arbeit hart»
28.05.2023

«Teilzeitarbeit ist dann ein Problem, wenn sie nicht wirklich freiwillig ist», Reiner Eichenberger. Bild: zvg