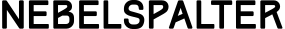Somms Memo
Die Badenfahrt, ein wunderbares Integrationsprogramm. Zur Geschichte eines grossen Festes
18.08.2023

Die Badenfahrt. 20 000 Einheimische, 1 Million Besucher. (Bild: Keystone)