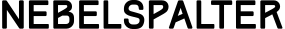Somms Memo
Zwei Forscherinnen haben herausgefunden, was alle ahnen: Die meisten Frauen kümmern sich kaum um eine Karriere
11.05.2023

Männer und Frauen im Büro. Mit unterschiedlichen Folgen.