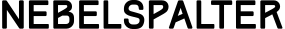Der Bergsturz im Lötschental hat die Schweiz erschüttert. Viele Politiker und manche Experten sagen nun, dass sich Bergstürze häufen würden und der Klimawandel daran schuld sei. Ueli Gruner, erfahrener Geologe und ehemaliger Dozent für Naturgefahren an der Universität Bern, warnt aber vor voreiligen Schlüssen. Der «Nebelspalter» hat mit ihm gesprochen.

Die wichtigsten Aussagen von Ueli Gruner:
«Es ist bisher nur eine leichte Häufung von grossen Bergstürzen festzustellen. Weil es aber sehr wenige solche Ereignisse gibt, sind statistische Aussagen schwierig.»
«In den letzten Jahrtausenden gab es jeweils in wärmeren Zeiten tendenziell sogar weniger Bergstürze als in kalten Phasen.»
«Bei grossen Bergstürzen wie jetzt im Lötschental ist ein Zusammenhang mit dem Rückgang des Permafrosts zurzeit unklar. Ich bin darum zurückhaltend, was Schuldzuweisungen an den Klimawandel angeht.»
«In Siedlungsgebieten in den Voralpen, wo es keinen Permafrost gibt, ist künftig nach warmen Wintern sogar mit weniger Felsstürzen zu rechnen.»
Interview:
Herr Gruner, Sie haben sich als Wissenschaftler intensiv mit Bergstürzen befasst. Wie haben Sie den Bergsturz im Lötschental erlebt?
Ueli Gruner: Ich habe vor einigen Jahren mehr als 200 Bergstürze in den letzten Jahrtausenden untersucht. Aber ein solches Ereignis wie in Blatten ist mir nicht begegnet. Es sind hier mehrere Millionen Kubikmeter Gestein auf einen Gletscher gefallen, bis dieser Gletscher unter dem Gewicht kollabiert ist. Das habe ich bisher nicht gesehen.
Dann handelt es sich wirklich um ein Jahrtausend-Ereignis, wie Bundesrat Albert Rösti sagte (siehe hier)?
Ich bin vorsichtig mit solchen Bezeichnungen. Sicher war es aber ein Ereignis, das ausserordentlich für den ganzen Alpenraum ist.
Die Einordnung dieses Ereignisses läuft auf Hochtouren. Boris Previšić, Direktor des Instituts für Kulturen der Alpen, hat in den Medien gesagt, dass es heute zehnmal mehr Bergstürze gebe als vor 50 Jahren (siehe hier und hier). Stimmt das?
Nein. Previšić nimmt eine Statistik, die wissenschaftlich nicht fundiert ist, und leitet davon eine süffige Behauptung ab. Und dann suggeriert er auch noch, dass der Klimawandel schuld sei an der angeblichen Häufung von Bergstürzen. So kann ein Literaturforscher wie Previšić vielleicht vorgehen, wenn er einen Roman schreibt. Wissenschaftlich gesehen ist seine Aussage aber nicht haltbar.
Was ist denn richtig?
Zwischen 1900 und 2000 ereignete sich etwa alle fünf bis zehn Jahre ein Bergsturz mit mehr als einer Million Kubikmeter Gestein. Seit der Jahrtausendwende gab es fünf bis sieben weitere solche Ereignisse. Es ist also eine leichte Häufung von Bergstürzen festzustellen.
Man hat aber schon den Eindruck, dass es einen klaren Trend gibt: der Bergsturz von Bondo 2017, die Räumung des Bündner Dorfes Brienz, jetzt das Ereignis von Blatten, und so weiter.
Es gibt in den letzten 20 bis 30 Jahren zwar bei kleineren und mittelgrossen Felsstürzen im hochalpinen Bereich eine Tendenz zu mehr Ereignissen. Aber grosse Bergstürze wie jetzt im Lötschental gibt es so wenige, dass es aufgrund der Statistik schwierig ist, eine Aussage zu machen.
Boris Previšić stützt sich aber auf Ergebnisse von Wilfried Haeberli. Und der ist immerhin Professor für Glaziologie an der Universität Zürich.
Ich kenne Wilfried Haeberli und habe mit ihm schon mehrere Sträusse ausgefochten. Man muss wissen, dass er Gletscherforscher ist, mit wenig Erfahrung, was Bergstürze angeht. In der wissenschaftlichen Literatur ist Haeberli nicht damit aufgefallen, dass er sich vertieft mit Sturzprozessen befasst hätte.
Sie haben Bergstürze der letzten Jahrtausende untersucht. Gibt es denn da einen Trend zu mehr Ereignissen?
Nein. Nach dem Ende der letzten Eiszeit vor etwa 12’000 Jahren wurden viele Hänge von der Last des Eises befreit. Entsprechend kam es zu vielen grossen Bergstürzen. Derjenige von Flims ist das bekannteste Beispiel. In den Zeiten danach gibt es aber keinen klaren Zusammenhang, dass es in wärmeren Zeiten zu mehr Bergstürzen gekommen wäre. Es gibt sogar einen gegenteiligen Trend zu mehr Ereignissen in kalten Phasen. Allerdings ist die Statistik diesbezüglich nicht sehr robust.
Öffentlich wird nun behauptet, dass die Erderwärmung schuld sei am Bergsturz von Blatten. «Es hat einen Zusammenhang mit dem Klimawandel», sagte etwa die grüne Politikerin Katharina Prelicz-Huber (siehe hier).
Ich bin zurückhaltend, was solche sofortigen Schuldzuweisungen angeht. Ich bin zwar selbst ehemaliger grüner Politiker in der Stadt Bern, halte mich aber an die wissenschaftlichen Daten. Leider gibt es eine unschöne Tendenz, jedes Mal, wenn etwas passiert, den Klimawandel als Ursache zu bezeichnen.
Aber die Aussage, dass wegen des Klimawandels der Permafrost verschwindet und das Gestein darum instabil wird, tönt einleuchtend.
Es lässt sich wissenschaftlich zwar belegen, dass der Rückgang des Permafrosts im Hochgebirge zu mehr Felsstürzen bis 100’000 Kubikmeter Gestein führt. Aber bei den grossen Bergstürzen wie jetzt im Lötschental ist ein Zusammenhang mit dem Permafrost zurzeit unklar. Bei solchen Ereignissen spielen andere Faktoren wie die Trennflächen im Gestein und der Wasserdruck in den Klüften eine entscheidende Rolle für die Destabilisierung eines Gebirges. Ich empfinde es als anstrengend, dass das Thema Permafrost nun so intensiv bewirtschaftet wird.
Sie haben in früheren einem Interview gesagt, es sei in Siedlungsgebieten sogar mit weniger Felsstürzen zu rechnen. Wie kommen Sie darauf?
Es geht um Siedlungsgebiete in den Voralpen, wo es keinen Permafrost gibt. Wenn es hier einen sehr kalten Winter gibt, dann zieht sich das Gestein zusammen und die Klüfte gehen auf. Wasser kann in diese Klüfte eindringen. Im Frühling taut das Ganze auf und wird instabil. Seit wir aber weniger kalte Winter haben, gibt es auch weniger solche Destabilisierungsprozesse.
Sie machen klare Aussagen. Wie ist es zu erklären, dass trotzdem überall Experten auftauchen, die behaupten, Bergstürze hätten zugenommen, und das liege am Klimawandel?
Da kann ich nur Vermutungen anstellen. Ein solcher Vorfall wie der im Lötschental wird natürlich auch parteipolitisch sofort in Beschlag genommen. Aber die Natur ist sehr viel komplexer, als manche Leute meinen. Man kann darum selten eindeutig sagen, warum es zu einem bestimmten Ereignis gekommen ist.
Der erwähnte Forscher Wilfried Haeberli war Mitglied des Initiativkomitees der Gletscherinitiative, die ein Verbot von fossilen Brennstoffen ab 2050 forderte. Kann es sein, dass er politisch befangen ist?
Dazu möchte ich nichts sagen. Ich äussere mich hier als Geologe, nicht als Politiker.
Was ist künftig zu erwarten? Wird der Klimawandel eben doch zu mehr Ereignissen in den Alpen führen?
Was kleinere Felsstürze im hochalpinen Raum angeht, ist eine Häufung zu erwarten. Wichtig ist, dass wir die Instrumente haben, um solche Ereignisse rechtzeitig zu detektieren, auch mithilfe von Satellitenaufnahmen. In den tieferliegenden Bereichen wird es wie gesagt eher weniger Felsstürze geben. Bei Bergstürzen, also den ganz grossen Ereignissen, bin ich sehr zurückhaltend mit einer Prognose. Es gilt jedenfalls, aufmerksam zu bleiben.