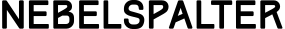In den ersten Monaten des Krieges in der Ukraine, insbesondere bis Ende März 2022, standen die Ukraine und Russland kurz vor einem echten Frieden. Doch warum kam es schlussendlich nicht zu einem Friedensabkommen und was bedeutet dies für die Friedenskonferenz auf dem Bürgenstock?
Die Schweiz ist nun mitverantwortlich für den Krieg

Um die Gründe für das Scheitern herauszufinden, untersuchten der Politikwissenschaftler Samuel Charap und der Historiker Sergey Radchenko die Entwürfe des Abkommen, führten eigene Interviews mit Teilnehmern der Verhandlungen durch und stützten sich auf Interviews, die grösstenteils auf YouTube verfügbar, aber nicht auf Englisch und daher im Westen kaum bekannt sind. Ihre Ergebnisse haben sie in einem Artikel in «Foreign Affairs» veröffentlicht. Die «NZZ» hat Teile des Artikels auf Deutsch veröffentlicht.
Diplomatische Annäherung und Fortschritte
Von Februar bis März 2022 fanden mehrere persönliche und virtuelle Gesprächsrunden zwischen ukrainischen und russischen Unterhändlern statt. Die Gespräche mündeten in das Istanbuler Communiqué, das einen Rahmen für eine mögliche Friedenslösung skizziert.
Demnach würde die Ukraine auf Nuklearwaffen verzichten und sich als neutraler Staat deklarieren und im Gegenzug Sicherheitsgarantien von verschiedenen Staaten, darunter auch von Russland, erhalten. Für das Scheitern dieses Friedens machen die Autoren mehrere Gründe verantwortlich:
- Zurückhaltung des Westens: Die westlichen Partner Kiews haben gezögert, sich auf Verhandlungen einzulassen, die zu neuen Sicherheitsverpflichtungen führen könnten, was die Schaffung robuster Sicherheitsgarantien für die Ukraine erschwerte.
- Öffentliche Meinung und Gräueltaten: Die Aufdeckung russischer Gräueltaten in Orten wie Irpin und Butscha hat die öffentliche Meinung in der Ukraine verhärtet und die politische Akzeptanz möglicher Zugeständnisse verringert.
- Ukrainisches Selbstvertrauen: Nach dem Scheitern der russischen Einkreisung Kiews ist Präsident Wolodimir Selenski zuversichtlicher geworden, mit ausreichender westlicher Hilfe einen Sieg auf dem Schlachtfeld erringen zu können.
- Ehrgeizige Ziele: Beide Seiten verfolgten ehrgeizige Ziele, indem sie versuchten, langjährige Streitigkeiten umfassend zu lösen, anstatt zunächst nur einen Waffenstillstand zu erreichen.
Neue Realitäten im dritten Kriegsjahr
Bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass diese Gründe im Sommer 2024 kaum noch zutreffen:
- Westliche Unterstützung: Anders als zu Beginn des Krieges hat der Westen inzwischen seine Zurückhaltung aufgegeben. Was anfangs noch tabu war – etwa die Entsendung von Kampfflugzeugen oder das Anpeilen von Zielen innerhalb Russlands – hat der Westen schrittweise akzeptiert. Dass er auch Sicherheitsgarantien für die Ukraine leisten würde, liegt auf der Hand.
- Andere Kriegsrealität: Die Massaker von Irpin und Butscha stehen längst nicht mehr im Zentrum der öffentlichen Wahrnehmung des Krieges. Im Jahr 2024 dominieren Themen wie Kriegsmüdigkeit – inzwischen sind über 100’000 ukrainische Soldaten im Krieg gefallen – und die erneute Angst vor einer russischen Invasion in der Region Charkiw. Die Ukraine zögert mit der Einführung der Zwangsrekrutierung, aus Angst vor der Stimmung im Land. Der Druck auf Wehrpflichtige im Ausland wird erhöht.
- Geänderte Ziele: Die veränderte Kriegsrealität hat zu einer Anpassung der Kriegsziele geführt.
-
In einem Interview mit der «New York Times» denkt der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski bei der Frage nach dem Kriegsende offen über seinen eigenen Tod nach. Die Rückgewinnung der Krim, die er noch 2022 lautstark forderte, ist in weite Ferne gerückt.
-
Auch Wladimir Putin scheint seine ursprünglichen Kriegsziele nach unten korrigiert zu haben. Anfangs sprach er der Ukraine das Existenzrecht ab – jetzt gibt er sich mit dem aktuellen Frontverlauf zufrieden. Das jedenfalls scheint er über «Reuters» durchsickern zu lassen.

Verpasste Chance: Schweizerische Friedenskonferenz
Was bedeuten diese Erkenntnisse für die Friedenskonferenz auf dem Bürgenstock? Wenn sich die Realitäten auf dem Schlachtfeld und die Ziele der Beteiligten so verändert haben, dann wäre mehr als ein Stelldichein der Ukraine und ihrer Freunde möglich gewesen – vielleicht sogar erste Schritte zu einem wirklichen Frieden. Mit jedem diplomatischen Austausch steigt die Chance auf einen Waffenstillstand. Mit jedem Waffenstillstand steigt die Chance auf einen dauerhaften Frieden.
Leider steht schon jetzt fest: Auf dem Bürgenstock wird es wohl keinen Waffenstillstand, geschweige denn einen Frieden geben. Das liegt daran, dass wichtige Akteure wie China und Brasilien dem Treffen fernbleiben. Dies deswegen, weil die Kriegspartei Russland nicht dabei ist, wie die beiden BRICS-Staaten in einer gemeinsamen Forderung nach Friedensverhandlungen mit beiden Ländern betonen. Die Verantwortung für das Fernbleiben Russlands liegt vor allem bei der Schweiz.
Die Rolle der Schweiz
Von Anfang an standen die Ukraine und ihr Präsident im Zentrum der Friedenskonferenz. Die gesamte Prämisse eines zu verhandelnden Friedens, die «Friedensformel» stammt von der Ukraine. Das Gipfeltreffen wurde in Anwesenheit von Wolodimir Selenski angekündigt – an sich schon ein diplomatischer Coup für die Ukraine und eine Blamage für Russland.
Zwar wurde immer wieder versucht, Russland die Hand zu reichen (siehe hier). Doch äusserte sich Bundespräsidentin Viola Amherd zu Beginn des Jahres in einem Interview mit den CH Media Zeitungen nur allzu deutlich: «Russland wird wohl kaum dabei sein, aber mit allen anderen suchen wir jetzt das Gespräch.» Bis Ende Mai hatte Russland gemäss EDA keine Einladung erhalten. Jetzt – in den letzten zwei Wochen vor der Konferenz – wurde nochmals ernsthaft versucht, Russland zur Teilnahme zu bewegen. Viel zu spät.
Fehlendes Vertrauen
Russland machte dem EDA gegenüber jedoch deutlich, dass es eine Einladung nicht annehmen würde. Russland nehme die Schweiz nicht als neutralen Vermittlungspartner wahr, sondern als «feindseligen Staat». Die Schweiz schaffte es nicht, Russland zu überzeugen, eine Einladung anzunehmen, auch weil in Moskau der Eindruck entstanden ist, dass die Schweiz lieber sklavisch bei EU-Sanktionen mitmacht, statt strikt neutral zu bleiben. Wer der Kriegspartei EU gefallen will, verspielt seine Rolle als Vermittler.
Nun ist nicht einmal der amerikanische Präsident an der Konferenz anwesend. Die Entsendung von Vizepräsidentin Kamala Harris anstelle von Joe Biden zeigt, wo die Prioritäten der US-Regierung liegen: Den G7-Gipfel in Italien, genau einen Tag vor der Schweizer Friedenskonferenz, besucht der Präsident höchstpersönlich. Danach fliegt er nach Kalifornien, um mit Hollywood-Stars Wahlkampf zu machen.
Die Schweiz wollte Verantwortung in der Gestaltung des Friedens übernehmen, trägt jetzt aber eine Mitschuld am Fortsetzen des Krieges.