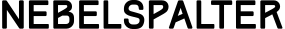Sexuelle Gewalt unter Jugendlichen
Kriminologe zu Jugendgewalt: «Das liegt am bildungsfernen, migrantisch geprägten Milieu»
16.11.2022

Eltern in Zwingen (BL) schafften sich im November vor einem Jahr Gehör, nachdem Kinder im Kindergartenalter angaben, sie seien von Schulkameraden aus der Sekundarschule missbraucht worden. Bild: D. Wahl