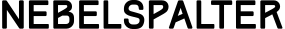Somms Memo
Fast eine Million Leute arbeiten in der Schweiz für den Staat. Das zeigt ein Gruselfilm von Avenir Suisse.
27.04.2023

Beamten auf dem Weg ins Büro, wo sie andere Beamten im Büro treffen.